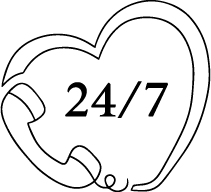Trauer nach einem Suizid
Was ist Trauer und warum trauern wir?
Die Verarbeitung von Trauer ist ein natürlicher und normaler Prozess. Jeder Mensch verarbeitet den Verlust eines geliebten Menschen auf seine eigene Art und Weise. Dabei ist es wichtig, sich mit dem Verlust auseinzusetzen und ihn zu verarbeiten, denn sonst kann es unter Umständen zu psychischen Problemen kommen.
Trauer wird durch den Verlust von Dingen, Lebensumständen oder geliebten Personen ausgelöst. Durch diese Faktoren kann das seelische Gleichgewicht der Hinterbliebenen durcheinandergebracht werden. Der Prozess der Wiederherstellung dieses Gleichgewichts wird als Trauer bezeichnet. Trauer ist eine Emotion, die uns alle auf unterschiedliche Weise betrifft. Sie kann auf der persönlichen, spirituellen, sozialen und körperlichen Ebene auftreten. Trauer kann sich in vielen Formen zeigen: in Traurigkeit, Wut, Schuldgefühlen, Angst oder sogar physischem Schmerz
Trauer aus bindungstheoretischer Sicht
Der Psychologe John Bowlby erklärt dies mit unserem angeborenen Bindungsverhalten: Von Geburt an sind wir auf enge Beziehungen angewiesen, um Sicherheit und Schutz zu erfahren. Wenn solche Bindungen durch Tod oder Trennung enden, empfinden wir Trauer als Ausdruck des Schmerzes über den Verlust dieser wichtigen Verbindung.
Warum trauern wir?
Trauer ist eine natürliche Reaktion auf Verlust und ein wesentlicher Bestandteil des Abschiednehmens. Sie gehört untrennbar zum menschlichen Leben und geht weit über den Tod hinaus – Trauer kann in vielen Situationen auftreten, auch bei Trennungen. Jeder Mensch braucht Zeit, um einen Verlust zu verarbeiten und ihn in das eigene Leben zu integrieren. Deshalb ist es entscheidend, dass wir als Gesellschaft Trauer und Trauernde anerkennen, um ihnen den Raum zu geben, den sie für diesen Prozess benötigen.
Trauer ist individuell
Trauer ist ein zutiefst persönlicher Prozess, der bei jedem Menschen unterschiedlich verläuft. Individuelle emotionale Muster, Lebenserfahrungen und Bewältigungsstrategien prägen, wie wir mit Verlusten umgehen. Was für die eine Person tröstlich ist, kann für eine andere belastend sein. Manche finden Trost in sozialen Aktivitäten, während andere Ruhe und Alleinsein bevorzugen. Die Anerkennung dieser Individualität ist entscheidend, um Trauernden den Raum und die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen.
Trauer ist kulturell geprägt
Kulturelle Hintergründe und soziale Normen beeinflussen ebenfalls die Art und Weise des Trauerns. In einigen Kulturen wird eine öffentliche und expressive Trauer erwartet, während in anderen Zurückhaltung üblich ist. Zudem spielt die Beziehung zum Verstorbenen eine entscheidende Rolle: Der Verlust eines Ehepartners kann anders empfunden werden als der eines Freundes oder entfernten Verwandten.
Die 5 Phasen der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross
Eine der bekanntesten Theorien über den Trauerprozess stammt von Elisabeth Kübler-Ross. Ihr Modell beschreibt fünf Phasen, die Menschen oft durchlaufen, wenn sie mit einem Verlust konfrontiert sind. Aber eins sollte man auch nie vergessen: Diese Phasen verlaufen nicht immer gleich. Und jeder trauert anders.
Phase 1: Nicht-wahrhaben-wollen
Die erste Reaktion auf einen Verlust ist oft das Leugnen. Viele Menschen weigern sich, die Realität des Verlustes anzuerkennen. Diese erste Reaktion auf einen Tod ist ein Schutzmechanismus des Körpers und gibt einem Zeit, das Schicksal zu verarbeiten.
Phase 2: Zorn
Emotionen wie Zorn, Wut oder Ärger sind ganz natürlich und helfen bei der Verarbeitung eines Verlustes. Diese Reaktionen können sich gegen uns selbst, andere Menschen oder sogar an die verstorbene Person richten. Wut hilft den Hinterbliebenen, mit dem Verlust besser klarzukommen. Wenn man die Wut unterdrückt, kann das zu Depressionen und Feindseligkeit führen. Es ist wichtig, dass Trauernde ihre Wut auf verschiedenste Arten ausdrücken. Sie können darüber reden, Tagebuch schreiben, auf ein Kissen schlagen oder sich durch Spaziergänge oder Sport abreagieren.
Phase 3: Verhandeln
In der Verhandlungsphase versucht man, eine Lösung zu finden, um den Verlust rückgängig zu machen. Das kann zum Beispiel in Form von Gedanken wie „Wenn ich nur…“ oder „Hätte ich doch nur…“ passieren. In dieser Phase haben die Hinterbliebenen oft Schuldgefühle, weil sie versuchen, die Kontrolle über das Geschehene zurückzugewinnen.
Phase 4: Depression
Die Phase der Depression ist für die meisten Menschen die schwierigste. In dieser Phase kommt die volle Wirkung des Verlustes zum Tragen, was zu tiefer Traurigkeit und Rückzug führen kann. In dieser Phase wird einem das ganze Ausmaß des Verlustes klar und man kann sich oft hoffnungslos oder leer fühlen. Wichtig ist, sich in dieser Zeit selbst mit Verständnis zu begegnen und zu erkennen, dass diese Gefühle ganz normal sind.
Phase 5: Akzeptanz
In der letzten Phase beginnt man, den Verlust zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass der Schmerz wie verschwunden ist, aber er lässt sich besser aushalten. Die Akzeptanz ist jener Punkt, an dem man wieder nach vorne schaut. Die Trauer um den verstorbene Menschen wird immer ein Teil des Lebens bleiben.
Individuelle Unterschiede im Trauerprozess
Das Modell von Kübler-Ross kann eine gute Orientierung bieten, aber jeder Mensch trauert auf seine eigene Weise. Jeder erlebt und verarbeitet Trauer unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Menschen, die ihre Gefühle sehr intensiv und unmittelbar spüren, während andere dafür etwas länger brauchen.
Auch kulturelle und religiöse Aspekte spielen eine Rolle, wenn es darum geht, wie man Trauer erlebt und zum Ausdruck bringt. In manchen Kulturen gibt es feste Rituale und Zeiträume für Trauer, in anderen ist die Trauer eher privat und still. Für manche Menschen sind religiöse Überzeugungen eine Art Trost, weil sie ihnen Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod oder auf eine spirituelle Verbindung bieten.
Strategien für den Umgang mit Trauer
Der Umgang mit der Trauer ist ein individueller Prozess, daher gibt es auch nicht den richtigen oder falschen Weg, um mit einem Verlust umzugehen. Jedoch gibt es einige Methoden, die helfen können, durch schwierige Zeiten zu kommen.
- Selbstfürsorge
In der Trauerzeit ist es wichtig, auch an sich selbst zu denken. Das heißt, man sollte versuchen, ausreichend zu schlafen, regelmäßig zu essen und sich auch mal zu bewegen, selbst wenn es schwerfällt. Manchmal heißt Selbstfürsorge auch, dass man sich Zeit nimmt, um die eigenen Gefühle zu verstehen und zu verarbeiten.
- Gespräche und Unterstützung
Es ist ganz normal, dass einen die Trauer isolieren kann. Aber es ist wichtig, sich nicht allein damit zu fühlen. Unterstützung durch Freunde, Familie oder einen Therapeuten kann dabei helfen, die eigenen Gefühle besser zu ordnen und sich weniger allein zu fühlen. Man kann sich auch einer Selbsthilfegruppe anschließen. Dort kann man sich mit Menschen austauschen, die Ähnliches erlebt haben.
- Trauer als Prozess akzeptieren
Es ist wichtig, Trauer als einen länger anhaltenden Prozess anzuerkennen und den Schmerz nicht zu ignorieren oder zu verdrängen. Es ist normal, dass die Trauer in unterschiedlichen Phasen kommt und geht. Wenn man sich erlaubt, die Trauer in ihrem eigenen Tempo durchzuleben, findet man nach und nach Heilung.
Fazit zu Trauer
Trauer ist ein tiefgreifendes und oft schmerzhaftes Gefühl, mit dem jeder von uns früher oder später konfrontiert wird. Wenn wir verstehen, wie Trauer funktioniert und akzeptieren, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg durch diese Emotionen geht, können wir uns selbst und anderen besser helfen. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, sich Unterstützung zu suchen und zu akzeptieren, dass Trauer ein ganz natürlicher Teil des Lebens ist. Auch wenn es schwer ist: Die Trauer hilft uns, wieder gesund zu werden und eines Tages nach vorne zu schauen.
Mehr zu den Trauerphasen von Elisabeth Kübler-Ross können Sie hier nachlesen.